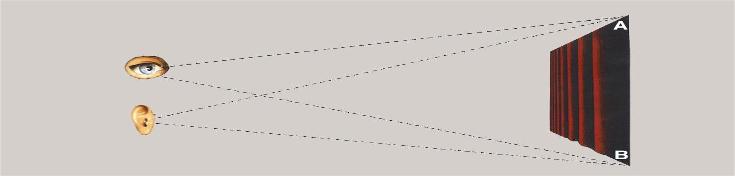Die Geschichte einer Suggestion
Roman
(Suhrkamp)
Erster Platz der Südwestfunkbestenliste, Dezember 2010
Literaturpreis der Stadt Düsseldorf, Juni 2011
Nominiert für den „Preis der SWR-Bestenliste 2011“
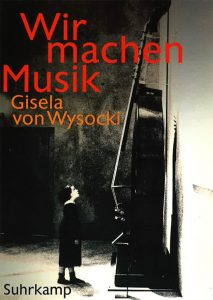 Der Vater, ein Pionier der frühen Schellack-Kultur, holt in den zwanziger und dreissiger Jahren die Tanz- und Varietéorchester Berlins ins ODEON-Aufnahmestudio. Später bringt er regelmässig eine neue schwarze Scheibe mit, aus der zum Schrecken der Tochter laute Musik zu hören ist. Er erscheint ihr als Zauberer, der ganze Orchester in das winzige Format der Schallplatte hineinzwängen kann. Um herauszufinden, was es mit der väterlichen Welt der Musik auf sich hat, nimmt sie Klavierunterricht, studiert Couplets und kleine Tänze ein – scheitert aber mit jedem dieser Versuche auf skurrile Weise.
Der Vater, ein Pionier der frühen Schellack-Kultur, holt in den zwanziger und dreissiger Jahren die Tanz- und Varietéorchester Berlins ins ODEON-Aufnahmestudio. Später bringt er regelmässig eine neue schwarze Scheibe mit, aus der zum Schrecken der Tochter laute Musik zu hören ist. Er erscheint ihr als Zauberer, der ganze Orchester in das winzige Format der Schallplatte hineinzwängen kann. Um herauszufinden, was es mit der väterlichen Welt der Musik auf sich hat, nimmt sie Klavierunterricht, studiert Couplets und kleine Tänze ein – scheitert aber mit jedem dieser Versuche auf skurrile Weise.
Dinge konnten sehr gross, unmässig gross aussehen, ich halte den Atem vor ihnen an. Etwa der Mund der Mutter, eindringlich redend, unmisserständlich schweigend. Hochbeinige Spinnen, die im Sommer bis ins Innere des Hauses vordrangen. Die sich unter dem dünnen Leder ihrer Schuhe als kleine Buckel abzeichnenden Hühneraugen der Nachbarin. Die überzeugendste Leistung war dem Vater gelungen. Über weisse Klaviertasten und schwarze Scheiben gebeugt, spuckte er mit Hilfe einer loslaufenden Drehscheibe Musik aus, schwarze, lackfarbene Musik.
Stimmen
Eine hinreißende Familienstory der Nachkriegszeit, aus dem in Trümmern liegenden Berlin. Nichts wird ausgeleiert und selbstgefällig erzählt. Zeit und Zellen einer Lebensgeschichte, erzählt mit dem sprühenden Elan einer Autorin, die viel vom Tragischen weiß und die entlastende Funktion der Komik kennt. (Verena Auffermann, DIE ZEIT)
Eine raffiniert reflektierende Komposition kurzer Prosa-Szenen, die miteinander verfugt und zugleich gegeneinander geschnitten sind. Gisela von Wysockis dichtes Buch erinnert in seinen schönsten Passagen an Walter Benjamins „Berliner Kindheit“. (Peter von Becker, DER TAGESSPIEGEL)
Die Präzision, mit der Gisela von Wysocki ihre Ich-Erzählerin berichten lässt, verwandelt das Biografische in eine feingesponnene Literatur. Wie im Zoom rücken die Szenen nah heran, werden gefühlte Gegenwart. (Judith von Sternburg, FRANKFURTER RUNDSCHAU)
Die Fragen des Kindes werden ausgelöst durch das unerklärte Verschwinden von Künstlern. Es gelingt hier, das „Dritte Reich“ als akustisches Phänomen zu beschreiben. (Sigrid Löffler, Kulturradio rbb)
Für die gespensterhaften Verbindungen zwischen den Menschen und den Dingen hat diese Autorin ein untrügliches Gespür. So traumscharf hat noch kaum jemand vom Aufsetzen der Nadel auf die schwarzen Rillen erzählt. (Lothar Müller, Süddeutsche Zeitung)
WIR MACHEN MUSIK ist die Geschichte einer kulturellen Emanzipation und ein Sprachkunstwerk. Die Stimme der kleinen Ich-Erzählerin vermischt sich mit jener ihres erwachsenen Alter Ego zu einem wunderbar klaren und analytischen Erzählton. (Isabella Pohl, DER STANDARD, Wien)
Gisela von Wysocki packt die Musik in ihren Text – er singt und schreit und spielt und reißt die Leser einfach mit. Lautes Lachen ist eigene Begleitmusik der Lektüre. (Christina Weiss, LITERATUREN)
Die kurzen Kapitel bilden Erlebnisinseln von großer Eindringlichkeit. In die Szenen des kindlichen Erschreckens fällt immer wieder eine illusionslose, knappe und zupackende Stimme ein. So springt die Essayistin dem Kind bei und tritt dem Zauber mit Gegenzauber entgegen. (Jörg Plath, arte-tv)
Wie gut, daß sich Gisela von Wysocki den Blick für die Welt des Elternhauses bewahrt hat. Uns würde sonst eine der originellsten neueren Autobiographien fehlen. Ein Facettenreichtum von Tönen, analysierend, fasziniert, entzaubernd, ironisch und selbstironisch…, vorangetrieben von einer erzählerischen Verve, die einsteht für Lesevergnügen. (Walter Hinck, FAZ)